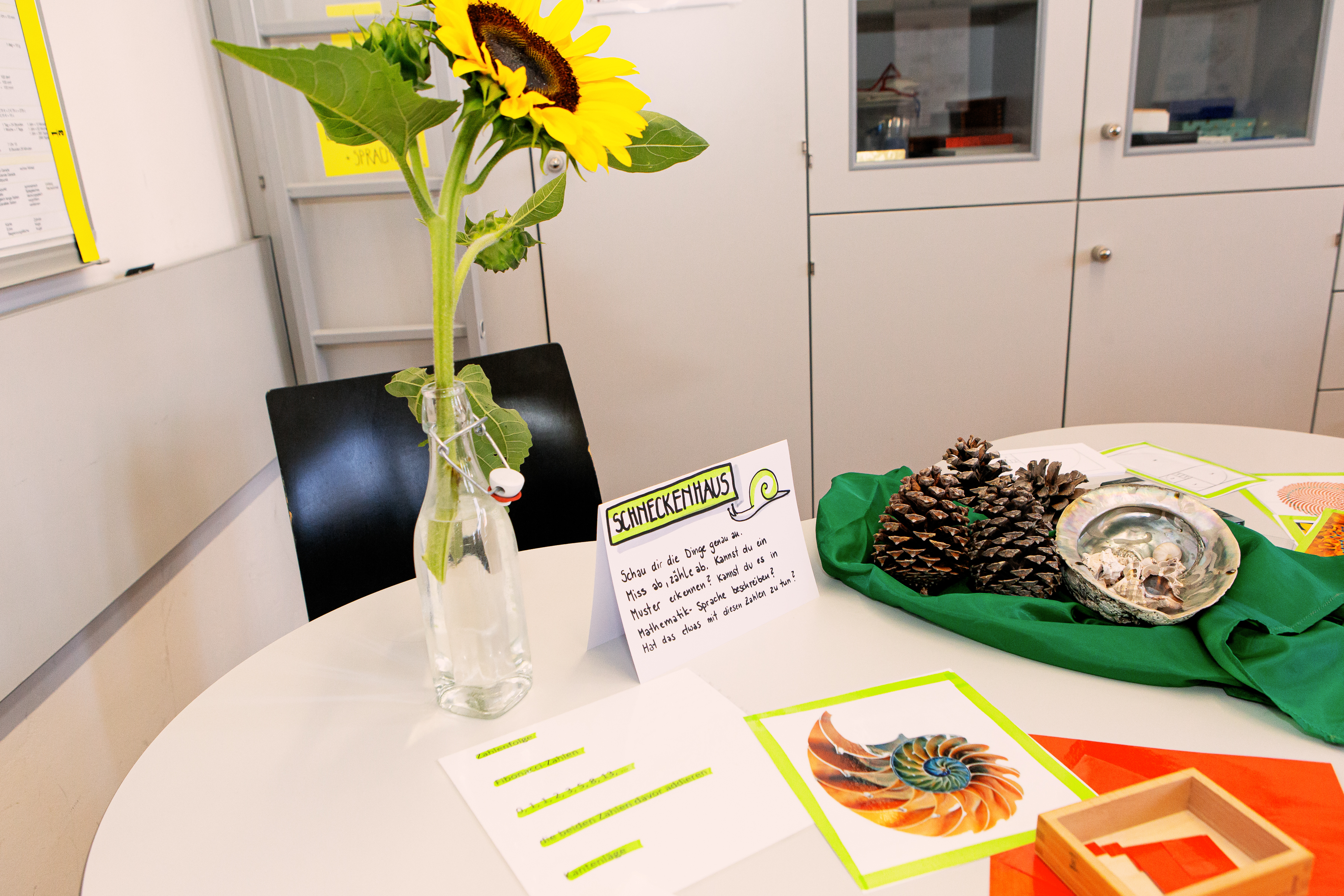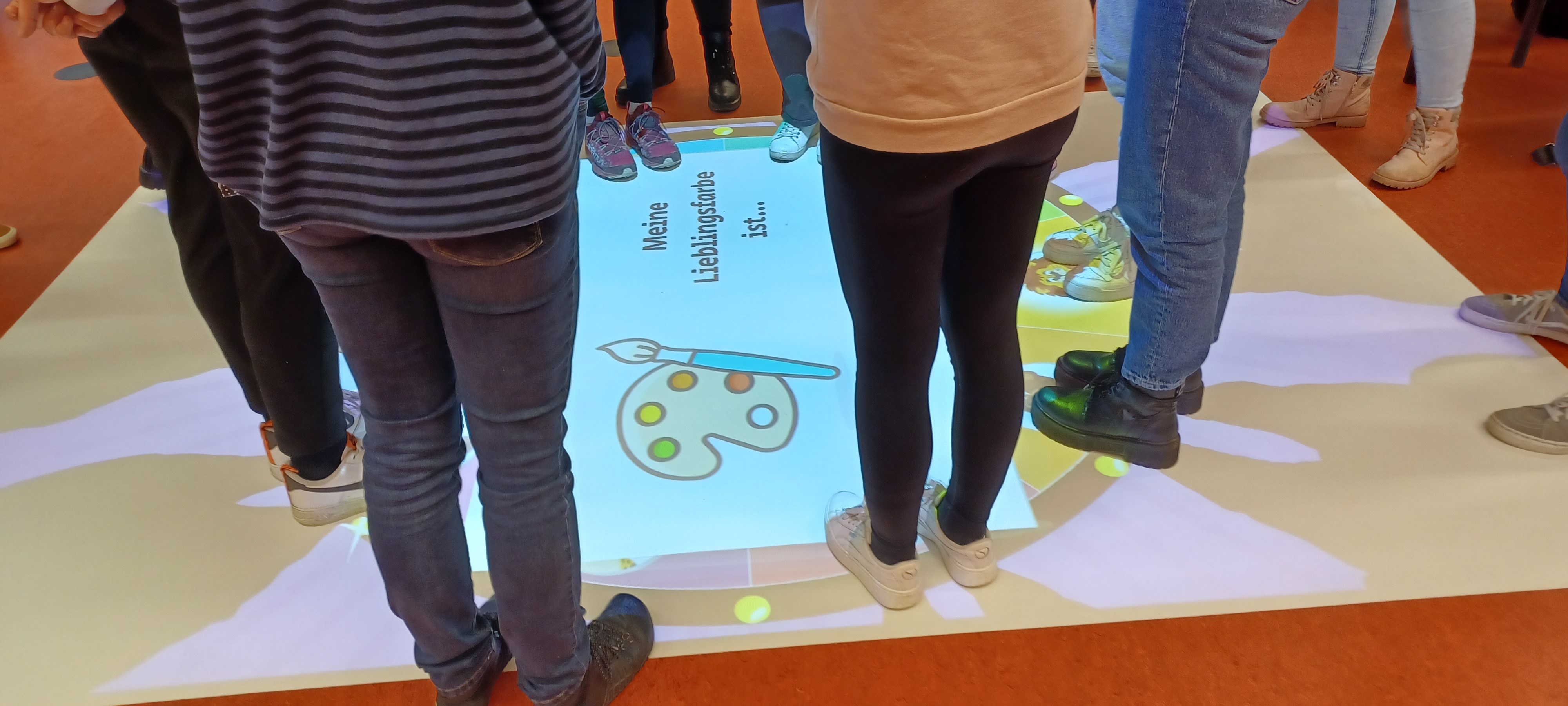- Start
- NeHle e.V.
- Hochschullernwerkstätten
- Tagungen
- Übersicht
- 2026 - Aufbruch
- 2025 - Halle
- 2024 - Graz
- 2023 - Trier
- 2022 - Frankfurt (digital)
- 2021 - Saarbrücken (digital)
- 2020 - Wien
- 2019 - Brixen
- 2018 - Erfurt
- 2017 - Bremen
- 2016 - Saarbrücken
- 2015 - Osnabrück
- 2014 - Berlin
- 2013 - Solothurn/Brugg
- 2012 - Siegen
- 2011 - Kassel
- 2010 - Linz
- 2009 - Halle
- 2008 - Berlin
- Literatur
- Kontakt
Forschung
Forschung in Hochschullernwerkstätten ist unumgänglich für deren Konzeptentwicklung und trägt darüber hinaus zur erziehungswissenschaftlichen und fachdidaktischen Diskussion bei. Sie orientiert sich an allgemeinen Prinzipien empirischer Sozialforschung, greift auf deren Methodologien und Methoden zurück und entwickelt diese auch weiter. Unter Forschung wird der nachvollziehbare Prozess der Gewinnung neuer Erkenntnisse, der Überprüfung bestehender Theorien, der Entwicklung innovativer Ideen sowie der Schärfung von Begriffen verstanden. Die wissenschaftlichen Arbeitsergebnisse werden publiziert und kritisch diskutiert. Forschung in Hochschullernwerkstätten hat einerseits die Funktion, grundlegende Erkenntnisse hervorzubringen und andererseits zur Weiterentwicklung konkreter Praxis beizutragen. Im Sinne des Wertfreiheitspostulats nach Max Weber kann durch Forschung „kein anwendbares Interventionswissen, jedoch Reflexionswissen“ (Böhme 2013, 739) erbracht werden. Je nach Einbindung ins Feld, als Praktiker*innen im eigenen pädagogischen Arbeitsgebiet oder aus distanzierter, handlungsdruckentlasteter Sicht, unterscheidet Prengel Wissenschafts- von Praxisforschung, denn die „unterschiedliche Zielsetzung, Erkenntnisreichweite, professionelle Identität und Expertise sind folgenreich.“ (Prengel 2013, 787) Im Rahmen von Hochschullernwerkstätten treten beide Formen auf. Wesentlich in diesem Zusammenhang sind die transparente Darstellung von Forschungszielen wie auch der jeweiligen Rollen der am Forschungsprozess Beteiligten. Perspektivisch könnte die Entwicklung spezifischer Forschungsansätze an Bedeutung gewinnen, die sich durch eine Nähe zur Lernwerkstattarbeit auszeichnen, wie z. B. der partizipative Forschungsansatz Forschende Lernwerkstatt (Grell 2013), die ethnografische Praxisforschung (Gruhn 2021) oder narrativ-deskriptive Forschungszugänge zum Lernen (Hoffmann & Herrmann 2024).
federführend: Dietlinde Rumpf
© 2024 lernwerkstatt.info | Impressum | Datenschutzerklärung |